Lera Auerbachs »Vessels of Light« im Konzert der Dresdner Philharmonie
An vielen Stellen leuchteten in den Nächten nach dem 9. November in Dresden jene Lichter, die zum Beispiel an Stolpersteinen zum Gedenken an die Pogromnächte aufgestellt worden waren. Die Dresdner Philharmonie hatte am Sonnabend ein Werk ihrer Composer in Residence Lera Auerbach ins Programm genommen, das sich dezidiert der jüdischen Geschichte, vor allem den Menschen, zuwendet. Dirigent François Leleux ist als Oboist und Kammermusikpartner eng mit Lera Auerbach, die zudem Pianistin ist, vertraut. »Vessels of Light« (»Lichtgefäße«, Deutsche Erstaufführung) greift Texte auf, die von Solisten und Chor auch auf jiddisch präsentiert werden, was – soviel vorab – nicht nur authentisch wirkte, den Eindruck der Zuwendung verstärkte, sondern im Konzert idiomatisch wie musikalisch aufging. Sozusagen ein Werk in einem passenden Kleid. Die Komponistin wollte nicht zuletzt die Stimmen fernlebender, geflohener oder verstorbener Menschen einschließen, wofür sie Flüstererrollen vorgesehen hat, die sich gerade wegen (oder trotz) der elektronischen Verstärkung als wirkungsvoll erwiesen, denn hier wurde auf das rechte Maß geachtet.
Natürlich darf man solch ambitionierte Werke, die nicht nur dem Erinnern dienen, sondern ganz explizit einen Standpunkt formulieren wollen (den Intendantin Frauke Roth in ihrem Vorwort »›Nie wieder‹ ist jetzt« unterstrich) trotzdem auch rein musikalisch wahrnehmen und hinterfragen. Etwa, ob »Vessels of Light« denn eine Sinfonie sei (die Komponistin zählt das Werk als 6. Sinfonie). Weder Verlauf oder Dramaturgie legen das nahe, vielmehr steht das gesprochene und gesungene Wort im Vordergrund. Gerade das gelang sehr gut, ja ausgezeichnet, denn mit dem Prager Philharmonischen Chor wurde erst kürzlich eine hervorragende Partnerschaft begonnen. Hinsichtlich Farbe, Kraft und Intensität, dem Vermögen, Worte herauszustreichen, blieb kein Wunsch offen – warum also mußte der Chor im Orchester stehen und dessen Sitzordnung geändert werden? Man sollte meinen, die gleiche Wirkung wäre auch in der gewohnten Sitzordnung erzielt worden.
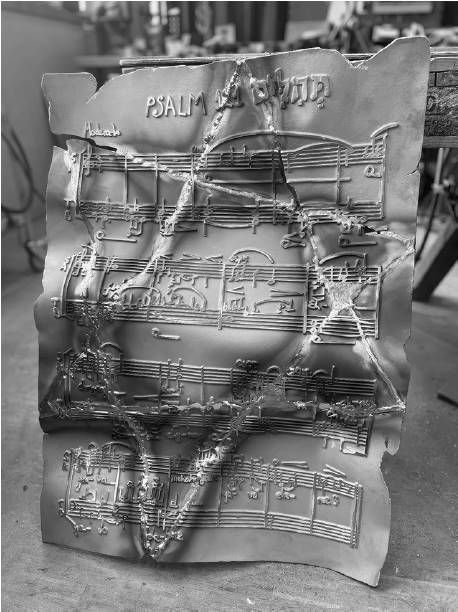
Dasselbe gilt für das Violoncello, gespielt von Kristina Reiko-Cooper: Ihre Rolle lag darin, die unterschiedlichen Strophen und Textteile zu verbinden, was ganz wunderbar gelang. Kristina Reiko-Cooper fügte den Solisten (Kristín Anna Guðmundsdóttir / Sopran, Luzia Tietze / Alt, Shine Lee / Tenor sowie Tomasz Wija / Baß) sozusagen eine fünfte Solostimme hinzu. Weshalb sie für den Epilog ihre Position verließ und an den rechten Orchesterrand wechselte, blieb unklar. Vielleicht kann man bei späteren Aufführungen die Vielzahl der Symbole und Bedeutungen reduzieren – der Text bliebe ja bestehen – er trägt das Werk.
Immer wieder ergaben sich ganz natürlich Momente der Annäherung, noch dazu leicht verfolgbar, denn die deutsche Übersetzung wurde über der Bühne eingeblendet. Worte wie »tröste« (ein Flüsterer), von Glockenschlag unterstrichen, bedürfen kaum zusätzlicher Erklärung. »Stille, Stille« (Luzia Tietze) wies auf einen schmerzlichen Verlust hin, nicht auf die Stille des Friedens, und hart gerissene Saiten im Teil »Verabschiedung« machten deutlich, daß hier keine normale Reise gemeint war (»Es rast der Zug, wie das Herz eines Verstoßenen«). Ergriffen, aber auch ein wenig strapaziert – da wirkte Felix Mendelssohns »Schottische Sinfonie« fast wie ein Ausgleich. Den einen erstaunte, dem anderen bestätigte, wie Mendelssohn, der Erfinder der »Lieder ohne Worte«, noch in seinen Sinfonien eine fast bildhafte Sprache zu finden wußte. Die Philharmonie interpretierte die »Schottische« luftig, ließ schroffe Konturen und kantige Felsklippen nicht missen.
12. November 2023, Wolfram Quellmalz
